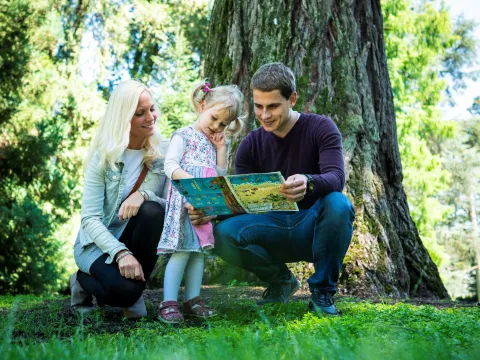Botanische Vielfalt erleben
Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – die Blumeninsel Mainau im Bodensee ist zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis und lädt Sie herzlich ein, Park und Gärten an der frischen Luft zu genießen. Sie bietet auf 45 Hektar faszinierende Ein- und Ausblicke und überrascht dabei immer wieder mit ihrer Blütenpracht.